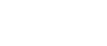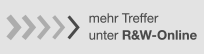Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr: Befreit oder im Gefängnis?

“Gefängnis raubet Herz und Mut auch einem unverzagten Manne”, lautet ein Sprichwort. Ähnlich mag es dem grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr im Zuge der Debatte um die Ende 2006 verabschiedete Dienstleistungs-Richtlinie 2006/123/EG (ABlEG Nr. L 376/36 v. 27. 12. 2006) ergangen sein.
Zur Erinnerung: Die Anfang 2004 von der Kommission vorgelegte Fassung wollte den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr von seinen Fesseln befreien, die ihm mitgliedstaatliche Bürokratie und Regulierung angelegt hatten. Ein Ausbruch sollte mit Hilfe einheitlicher Ansprechpartner als Anlaufstelle für die Abwicklung (nicht Bearbeitung) von Formalitäten und im Wege elektronischer Verfahrensdurchführung gelingen.
Zudem sollte beinahe jede Dienstleistungsform – seien es reisegewerbliche oder fremdenverkehrsbezogene Aktivitäten – in beinahe jedem Stadium – von der Firmengründung bis zur Vertragsabwicklung – vom Abbau investitionshemmender Rechtsnormen profitieren. Während der Entwurf bei dauerhafter Aktivität im Zielstaat vor allem auf eine Liberalisierung der marktzugangsbezogenen Genehmigungsanforderungen abzielte, sollte im Bereich vorübergehender Tätigkeiten ein generelles Herkunftslandprinzip eingeführt werden. Danach hätte der Unternehmer sein dienstleistungsbezogenes Heimatrecht in den Zielstaat mitnehmen dürfen – mit der Folge einer beinahe ausschließlichen Regulierung durch die dem Dienstleistungserbringer bestens vertraute Rechtsordnung.
Wie bei jedem Gefängnisausbruch waren aber die Wärter – also Parteien, Regierungen, und Verbände – nicht weit. Sie führten den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr in Umsetzung ihrer Gemeinwohlverantwortung – dessen Verurteilung erfolgte schließlich teilweise nicht zu Unrecht – in seine Zelle zurück. Kritisiert wurde zunächst der weite Anwendungsbereich der Entwurfsfassung, der sich z. B. auch auf Gesundheitsdienste bezog. Vor allem sollte aber das Herkunftslandprinzip wieder eingesperrt werden, da man befürchtete, dessen Einführung würde “Sozialdumping” und einen “race to the bottom” hin zu den niedrigsten Kontroll- und Qualitätsstandards bewirken.
Mehr und mehr geriet der grenzüberschreitende Dienstleistungsverkehr jedoch in Einzelhaft, was sich auch an den Spitznamen der Entwurfsfassung ablesen ließ. Nur auf den ersten Blick auslegungsoffene Bezeichnungen wie “Bolkenstein-Hammer” wechselten sich mit weniger charmanten Etiketten wie “Totengräber des europäischen Sozialmodells” ab. Noch dazu bewegten sich die Vernehmungsmethoden mancher Wärter am Rande der Legalität. So wurde teilweise auf die Gefahr der Entsendung osteuropäischer Billiglöhner hingewiesen, die bei Verabschiedung der Richtlinie zu “Lohndumping” führen würde, obwohl doch den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zur Fixierung von Mindestlöhnen (auch nach der Arbeitnehmerentsende-Richtlinie) gerade belassen worden wäre.
Es war einem Alternativvorschlag des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz zu verdanken, dass die Reststrafzeit für einige Elemente des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs nicht allzu lang bemessen war. Dieser sog. Gebhardt-Kompromiss setzte zunächst auf eine Begrenzung des Anwendungsbereichs der Richtlinie, aus der z. B. der Gesundheitssektor herausgenommen wurde.
Im Zentrum des Gegenentwurfs stand aber die Eliminierung des Herkunftslandprinzips für vorübergehende grenzüberschreitende Tätigkeiten – also der Verzicht auf einen generellen Import der heimischen Rechtsordnung. Stattdessen sollte der Grundsatz gegenseitiger Anerkennung eingeführt werden, wonach ein Unternehmer seine Dienste auch in anderen Mitgliedstaaten hätte anbieten dürfen, wenn er die Bedingungen seines Heimatlandes eingehalten und ihm keine Norm des Zielstaats entgegengestanden hätte. Das Bestimmungsland hätte jedoch keine generelle Regulierungsbefugnis mehr gehabt, sondern wäre insbesondere an das Verhältnismäßigkeitsgebot und an das Verbot von Doppelkontrollen gebunden gewesen.
Als Kompromiss zum Kompromiss einigte man sich bei vorübergehenden grenzüberschreitenden Diensten darauf, dem Zielstaat die Möglichkeit eines eigenen Regulierungs- und Überwachungssystems zu belassen, wenn dessen Normen nicht bestimmten verbotenen Anforderungen entsprechen (Art. 16 Abs. 2), auf Gründen des Umweltschutzes bzw. der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit (also nicht mehr auf jedwedem Rechtfertigungsgrund) beruhen und verhältnismäßig sowie diskriminierungsfrei sind (Art. 16 Abs. 1 Unterabs. 3). Der in der verabschiedeten Fassung der Dienstleistungs-Richtlinie reduzierte Anwendungsbereich ähnelt dem Gebhardt-Kompromiss, die übrigen Bestandteile weitgehend dem Ursprungsentwurf.
Im Bereich vorübergehender grenzüberschreitender Diensterbringung konnten sich jedoch trotz (oder gerade wegen) des langwierigen Gesetzgebungsverfahrens beinahe unbemerkt einige Bestandteile des Herkunftslandprinzips aus ihrem Gefängnis hinausschleichen, wobei den Wärtern Mitwisserschaft (oder Dienstpflichtverletzung) vorzuwerfen sein dürfte. Befreit hat sich vor allem der Marktzugang, da nunmehr Genehmigungs- und Anzeigepflichten untersagt sind. Damit ist dem Zielstaat die Möglichkeit einer Vorabkontrolle versperrt, zumal die an sich denkbaren Tätigkeitsverbote meist unverhältnismäßig sein dürften.
Ferner könnte auch dort ein Ausbruch gelingen, wo der Zielstaat aufgrund der Verkürzung möglicher Rechtfertigungsgründe keine eigenen Regeln mehr treffen kann. Manche Insassen sind aber am Überspringen der Mauern gehindert, weil z. B. kulturelle Dienste nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen. Die Flucht gelingt daher vor allem dort, wo früher verbraucherschützende Normen im Wege standen. Es ist jedoch (vielleicht sogar noch größere) Vorsicht geboten, weil nunmehr der Konsument selbst die Verfolgung im Zielstaat aufnimmt und nicht mehr dessen Behörden. Denn die Richtlinie schafft vielfältige Informationsmöglichkeiten (z. B. über die Rechtslage, den Unternehmer oder das Produkt) und geht daher vom mündigen Verbraucher aus – frei nach dem Motto: Das Recht ist für die Wachen da.
Im Ergebnis dürfte die Befreiung mancher Elemente des Herkunftslandprinzips kaum verwundern. Denn ein anderes Sprichwort sagt: “Gefangen Mann ist listig Mann.”
Dr. Stefan Korte, Göttingen