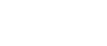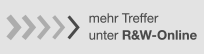Gestaltwandel des Internationalen Privatrechts

Der Autor Jahrgang 1942. Rechtsanwalt. Nach Tätigkeiten in der Kredit- und Energiewirtschaft Präsdent des Oberkirchenrates Schwerin. Professor an der Fachhochschule für Ökonomie und Management, Essen; Lehrauftrag für Internationales Wirtschaftsrecht an der Universität Dortmund. Autor zahlreicher wirtschaftsrechtlicher Veröffentlichungen.
Für eine Kodifizierung kommen der abstrakt-systematische und der detailliert-kasuistische Ansatz in Betracht. Alle Gesetze der Welt sind ein Gemisch beider. Der deutsche Rechtskreis ist wohl durch den ersten, der französische durch den zweiten geprägt. Das gilt auch für die nationalen Rechtsanwendungsgesetze, wie das IPR wohl richtiger genannt werden sollte. Genau und perfekt müsste für jede Vorschrift auch ihre kollisionsrechtliche Bedeutung geregelt werden, etwa wie folgt: § 1 BGB würde um einen Abs. 2 ergänzt: “Hätte das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit, entscheidet das deutsche Recht über die Frage, was ‘lebend’ bedeutet, das Recht am Orte der Geburt darüber, ob diese vollendet ist.” § 93 Abs. 2 AktG enthielte für die Schadensersatzhaftung des Vorstandsmitgliedes gegenüber der Gesellschaft den Zusatz, dass abweichend von der lex loci delicti das Gesellschaftsstatut entscheide usw.
Das wäre unsinnig. Die Fülle des Lebens, zumal die künftige des globalen Rechtslebens, erfasst man nicht durch Kasuistik – wenn überhaupt, dann nur durch Systembildung.
Das IPR war bis 1918, eigentlich bis zum Ende des 2. Weltkriegs nur etwas für the happy few mit ihren ausgefallenen Problemen. Das galt aus zwei Hauptgründen. Erstens: Fast nur die Oberschichten hatten internationale Interessen; nur diese heirateten schon mal fremde Staatsangehörige, domizilierten und starben im Ausland, ließen sich dort oder hier scheiden, besaßen bzw. vererbten Vermögen in verschiedenen Staaten usw. Die schönsten Beispiele aus Kegels Lehrbuch stammen aus diesem Milieu. Zweitens: Gut 80 % des Welthandels fand zwischen 3 bis 4 Staaten, folglich nach deren Recht statt. Weltweit gab es nur etwa 30 wirklich souveräne Staaten, die nicht entweder direkt Kolonien waren oder wie die kleineren lateinamerikanischen Staaten von den USA bzw. die arabischen von England indirekt wie solche geführt wurden. Von den souveränen Staaten nahm kaum ein Drittel am Welthandel teil, und das hier anwendbare Recht war dasjenige der alles beherrschenden Kolonialmacht England. Außereuropäisches Recht war Völkerkunde, nicht Recht. Viele heute das Wirtschaftsrecht prägende Rechtsbereiche, z. B. Urheberrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht oder Arbeitsrecht, gab es nicht oder erst in Anfängen. Es war auch uns schwer vorstellbar, dass es jemals so etwas geben würde wie türkisches Patentrecht, indisches Kartellrecht, chinesisches Urheberrecht usw.
Die Veränderungen sind grundlegend. Neue Staaten sind da, treiben Handel nach ihrem Recht, haben Patente nach ihren Gesetzen. Riesige Migrantenströme führen bei uns zu ehedem undenkbaren kollisionsrechtlich relevanten Fallzahlen. Gefestigte Grundsätze des IPR passen nicht mehr. So ist die Anknüpfung des Personalstatuts an die Staatsangehörigkeit für Fernausländer, die bei uns bleiben wollen, gegenüber der Wohnsitzanknüpfung völlig verfehlt. Niemand hat je errechnet, was es kostet, dass exotische Rechtsordnungen recherchiert werden müssen, wenn ein Vater unter Berufung auf den Koran oder ein Stammesrecht sein Kind entführt. § 293 ZPO, eine angemessene Vorschrift im Umfeld nah verwandter und sprachlich leicht zugänglicher Rechtsordnungen, zwingt zu unwirtschaftlichem und höchst fehlergeneigtem Aufwand. Insbesondere aber ist die heutige Staatenwelt eine andere. Über 200 Staaten agieren heute rechtlich selbstständig. Sie haben eigene Rechtsordnungen oder streben sie an, ist das doch eines der wichtigsten Kennzeichen von Staatlichkeit. Bei 5 Elementen (hier: Staaten) gibt es nach dem Permutationsgesetz 120 Kombinationen. Bei 200 liegen diese jenseits aller Grenzen des Kosmos. Damit sei, ohne weiteren juristischen Anspruch, nur auf die exponentielle Zunahme der theoretisch möglich gewordenen Fragen im IPR hingewiesen. Das IPR der Staaten war niemals so wichtig wie heute.
Diese Entwicklungen entziehen aber dem IPR tendenziell zugleich den Boden. Das Wirtschaftsrecht ist schon heute in Teilen Weltrecht (vgl. Abrufgarantie/Akkreditiv; TRIPS). Mächtige Strömungen zur Rechtsvereinheitlichung fließen noch ohne Mündung zu Tale. Die Konvention von Rom vom 19. 6. 1980 betrifft das auf Verträge anwendbare Recht. Aber in diesem wichtigen Bereich des Wirtschaftsrechts wird das IPR anscheinend immer unwichtiger. Billigkeit und lex mercatoria gelten im Schiedsverfahren heute als zulässige Rechtswahl. Für kollisionsrechtliche Fragen ist dann kaum noch Platz. Der im gegebenen Fall sich nach den kollisionsrechtlich in Betracht kommenden Rechtsordnungen ergebende Unterschied im materiellen Ergebnis ist oft gering. Steht der Aufwand zur Feststellung sowohl des anwendbaren Rechts als auch seines Inhalts immer in einem sinnvollen Verhältnis dazu (vgl. Aden, DZWiR 1997, 81)?
Gewiss, die Staaten werden noch lange ihr IPR benötigen. Aber welches? Jedes moderne IPR lässt sich auf folgende drei Sätze zurückführen: Art. 1 “Die lex fori anerkennt Rechte, die in einem anderen Staat nach dortigem Recht entstanden sind, wenn dieser zum Zeitpunkt der Rechtsentstehung für diesen Gegenstand die Regelungszuständigkeit hatte.”; Art. 2 “Ein Staat ist regelungszuständig, wenn der Schwerpunkt eines Gegenstandes bei ihm liegt.”; Art. 3 “Bei Gefährdung der eigenen öffentlichen Ordnung geht die lex fori vor.”
Das ist für ein modernes IPR-Gesetz zu wenig. Aber vor 100 Jahren wurden auch bei uns nicht einmal diese Grundsätze immer durchgesetzt. Es wäre daher schon etwas, wenn eine Art Welt-IPR nur erst diese wirklich zur Geltung brächte. Wenig sinnvoll erscheint es hingegen, wenn die Staaten detailreiche IPR-Gesetze mit unklarer Systematik ans Licht bringen. Wir können noch gar nicht wissen, wohin die Reise der weltweiten Rechtsvereinheitlichung und damit des IPR geht.
Wir sollten die Linde des IPR im globalen Dorf durch Systembildung langsam, vom Allgemeinen zum Besonderen, so zum Wachstum führen, dass sie, wie in einem schönen norddeutschen Dorf, Licht und Schatten, eigenes und fremdes Recht so spende, wie es gut ist.
Professor Dr. Menno Aden, Essen