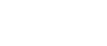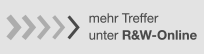Der literarische BGH – zweite Version eines unwissenschaftlichen Editorials

In RIW 2006, 845 sind die Leitsätze des BGH-Urteils vom 1. 8. 2006 in der Rechtssache “Restschadstoffentfernung” veröffentlicht. Als ich die Gründe dieses Urteils zum ersten Mal sichtete, entdeckte ich in den Ausführungen des BGH eine poetische Anmutung, die mich an Oscar Pastior erinnerte.
Der Dichter Oscar Pastior, Träger des Büchner-Preises 2006, der allerdings vor der Übergabe des Preises verstarb, zählte zu den großen Sprachakrobaten deutscher Zungenmuskeln. Sein Werk zeichnet sich aus durch idiomatischen Spielwitz, den beständigen Rückgriff auf rhetorische Konstrukte wie Anagramm und Palindrom sowie das unbändige Ausloten grotesker Sinnverbindungen. Wenn man einen seiner Texte liest – doch weit besser ist es, ihn sich laut vorlesen zu lassen – glaubt man zunächst, die Lautgebilde zu verstehen, bis man sich schnell eingestehen muss, dass man Klangimaginationen aufgesessen ist, die sich einer streng rationellen Entzifferung verweigern.
[In der ersten Version dieses Editorials folgte, um meinen Vergleich zu belegen, an dieser Stelle ein neuneinhalbzeiliges Zitat aus Pastiors Werkband “Minze Minze flaumiran Schpektrum”. Als gesetzestreuer Jurist bat ich Pastiors Verlag um eine Nachdruckgenehmigung. Diese wurde mir auch erteilt, allerdings mit der Auflage, eine Lizenzgebühr zu zahlen. Da dies meiner durch schwäbische Familienwurzeln tradierten Sparsamkeit widersprach, verweigerte ich die Zahlung und berief mich auf die Zitierfreiheit. Die Gegenseite klärte mich auf, dass ich damit falsch lag, weil es sich bei meinem Editorial nicht um ein wissenschaftliches Werk handele – was mich natürlich tief traf.]
Kommen wir zurück zu dem Urteil BGH, RIW 2006, 845 L. Rechtlich handelte es sich um – passenderweise! – eine Lizenzstreitigkeit: Der Kläger, Inhaber eines Patents zur Restentfernung von Schadstoffen aus Abgasen, verlangte von der Beklagten Gebühren, weil diese angeblich ein von dem Patent geschütztes Verfahren anwendete. Im Einzelnen: “. . . Zu den Merkmalen c und d [des Patents] hat das Berufungsgericht . . . ausgeführt, dass eine Quenche zwar auch eine begrenzte entstaubende Wirkung hat, dies aber für die Einhaltung der gesetzlichen Emissionswerte nicht ausreiche. Das Berufungsgericht hat aber verneint, dass die durch eine Quenche erzielte Entstaubungswirkung als Entstaubung im Sinn der Merkmale c und d verstanden werden könne und im Übrigen die Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen . . . mit der Begründung übernommen, aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns stelle eine Quenche in erster Linie einen Einspritzkühler zum plötzlichen Abschrecken eines Gases oder Gasgemischs dar, nicht jedoch eine Abscheideeinrichtung. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass eine Quenche in erster Linie als Entstaubungsanlage anzusehen sei. Am Verfahrensschritt d fehle es selbst dann, wenn Quenche und Rotationswäscher als Gesamtkomplex die Entstaubungszone gemäß Merkmal c bildeten. . . . Insgesamt habe der Sachverständige ausgeführt, dass der Anschlusswert der Düse nicht für eine kontinuierliche Bedüsung, sondern allein für einen Spülvorgang gedacht sei. Der Sachverständige habe die Düsen zwar selbst nicht gesehen, aber den Flanschansatz begutachten können. Ihm sei klar, welche Art Düsen bei welchen Flanschdurchmessern angebracht werden könnten. Er habe auch die Spülung in Betrieb und die 58-kW-Pumpe begutachten können. Ein Wasserfilm zum Besprühen könne nicht erzeugt werden. Selbst wenn man mit dem Kläger davon ausgehe, dass nicht eine ununterbrochene Bedüsung erforderlich sei, setze eine Zudosierung begrifflich eine Intervalldauer von unter 8 Stunden voraus. . . . Die Revision rügt zudem Vortrag zu den Merkmalen k1 bis k3 als übergangen, als Mittel im Sinn dieser Merkmale könne auch Wasser zudosiert werden, was bei der R. neben der periodisch im Abstand von 8 Stunden vorgesehenen Schwallspülung auch kontinuierlich über die Filterbedüsungen XIII und XIII' erfolge . . .”
Der BGH hat das Urteil des OLG aufgehoben, weil dessen Feststellungen die Abweisung der Klage nicht tragen:
“. . . Nach Merkmal c wird das aus der Verbrennungszone der Anlage abströmende und Schadstoffe enthaltende heiße Rauchgas entstaubt. Nach Merkmal d wird das ‘entstaubte’ Rauchgas einer Nachbehandlung unterzogen. Dem Begriff des ‘entstaubten’ Rauchgases kann sprachlich sowohl die Bedeutung zugeordnet werden, dass das Rauchgas nach Entstaubung staubfrei sein soll, aber auch die Bedeutung, dass nur ein Teil des vorhandenen Staubs entfernt worden sei. Von welcher Bedeutung auszugehen ist, muss durch Auslegung des Lizenzpatents geklärt werden. . . . Das Berufungsgericht ist dem . . . Sachverständigen zunächst darin gefolgt, das in einem ‘Einspritzkühler’, d. h. einer Quenche, das Rauchgas in gewissem Umfang entstaubt werde. Es meint aber, als Staubabscheider seien Einspritzkühler im Vergleich zu gängigen Nasswäschern nur von bescheidener Leistungsfähigkeit. Damit hat das Berufungsgericht aber eine Entstaubung, wenngleich mit geringem Wirkungsgrad, festgestellt, die fachüblich auch als hilfreich akzeptiert werde. . . . Darauf, ob die Quenchen Abscheideeinrichtungen darstellten, worauf das Berufungsgericht weiter abstellt, kommt es für die Verwirklichung der Merkmale c und d schon deshalb nicht an, weil diese eine solche Einrichtung nicht voraussetzten, sondern nur ein Entstauben, das das Berufungsgericht aber festgestellt hat. Es kam erst recht nicht darauf an, wie der Fachmann den im Patentanspruch 1 des Lizenzpatents nicht vorkommenden Begriff der Quenche versteht, sondern darauf, wie der Begriff der Entstaubung zu verstehen ist; das ist aber eine Frage der Auslegung des Lizenzpatents.”
Fazit: Lizenzdispute haben es immer in sich.
Dr. Roland Abele, Frankfurt a. M.