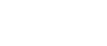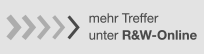Unwirksame Gerichtsstandsklauseln in “Lieferketten”

Im Wege eines vom französischen Kassationshof eingeleiteten Vorabentscheidungsverfahrens entschied der EuGH (RIW 2013, 245) Anfang 2013 über die Auslegung des Art. 23 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 (EuGVVO). Diesem Vorabentscheidungsverfahren lag ein Streit über den Verkauf von Kompressoren zugrunde. Die ursprünglich von dem italienischen Unternehmen Refcomp hergestellten Kompressoren wurden von einem zweiten italienischen Unternehmen (Climaveneta) erworben und zusammengesetzt. Die Kompressoren wurden anschließend von dem französischen Unternehmen Emerson erworben und an die ebenfalls französische OHG DOUMER weiterverkauft, die diese bei Renovierungsarbeiten eines Immobilienkomplexes zur Installation von Klimaanlagen benötigte. Als an der Klimaanlage Störungen festgestellt wurden und ein Gutachten belegte, dass diese Störungen auf einen Fehler in der Herstellung der Kompressoren zurückzuführen waren, verklagte die Versicherung der OHG DOUMER die Gesellschaften Emerson, Climaveneta und Refcomp gesamtschuldnerisch auf Schadensersatz vor dem Landgericht Paris. Die Gesellschaft Refcomp bestritt jedoch die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts und begründete diese mit der – in dem ersten Kaufvertrag, zwischen Refcomp und Climaveneta vereinbarten – Gerichtstandsklausel, der zufolge die italienischen Gerichte zuständig waren.
Dieses Vorbringen wurde sowohl in erster als auch in zweiter Instanz von den französischen Gerichten zurückgewiesen. Die Richter des Berufungsgerichts von Paris begründeten ihre Entscheidung mit der fehlenden Zustimmung seitens des späteren Erwerbers, der den vereinbarten Bedingungen des ursprünglichen Vertrages nie beigetreten wäre. Ferner seien die besonderen Regeln der EuGVVO ohnehin nur auf vertragliche Streitigkeiten anwendbar, das Produkthaftungsrecht begründe dagegen ausschließlich deliktische Ansprüche. Nach der erneuten Zurückweisung ihrer Argumentation legte Refcomp Revision beim Kassationshof ein. Letzterer stellte dem EuGH im Rahmen dieses Verfahrens zwei Fragen zur Vorabentscheidung, von denen nachfolgend allerdings nur eine genauer betrachtet werden soll:
“Entfaltet eine zwischen dem Hersteller und dem Käufer einer Ware im Rahmen einer Kette von Verträgen innerhalb der Gemeinschaft gemäß Art. 23 der Verordnung geschlossene Gerichtsstandsvereinbarung ihre Wirkungen gegenüber dem späteren Erwerber und, wenn ja, unter welchen Bedingungen?”
Der EuGH (RIW 2013, 245) hat die Frage wie folgt beantwortet:
“Art. 23 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 . . . ist dahin auszulegen, dass eine in dem Vertrag zwischen dem Hersteller eines Gegenstands und dem Erwerber vereinbarte Gerichtsstandsklausel dem späteren Erwerber, der diesen Gegenstand am Ende einer Kette von das Eigentum übertragenden Verträgen, die zwischen in verschiedenen Mitgliedstaaten ansässigen Parteien geschlossen wurden, erworben hat und eine Haftungsklage gegen den Hersteller erheben möchte, nicht entgegengehalten werden kann, es sei denn, es steht fest, dass dieser Dritte der Klausel unter den in diesem Artikel genannten Bedingungen tatsächlich zugestimmt hat.”
In seiner Begründung führt der EuGH aus, dass eine im Vertrag enthaltene Gerichtsstandsvereinbarung grundsätzlich nur den Parteien entgegengehalten werden kann, die dem Abschluss des konkreten Vertrages, in dem die Gerichtsstandsklausel enthalten ist, zugestimmt haben. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine Vertragsklausel immer die Zustimmung desjenigen erfordert, dem sie entgegengehalten werden soll. Es ist dementsprechend Aufgabe des nationalen Gerichts, so der EuGH, zu überprüfen, ob eine Einigung der betroffenen Parteien bezüglich der Gerichtsstandsvereinbarung auch tatsächlich vorliegt.
Während in Deutschland die Haftung des Herstellers im Rahmen des § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. dem Produkthaftungsgesetz eindeutig dem Deliktsrecht und damit dem außervertraglichen Schadensersatz zugeordnet werden kann, hat die französische Rechtsprechung über Jahre hinweg an dem “notwendigerweise vertraglichen Charakter” des Durchgriffs auf den Hersteller festgehalten (vgl. Cour de Cassation, Civ. 1ère, 9. 10. 1979, 78-12.502). Der vertragliche Charakter der Haftung ließ sich nach Meinung des Kassationshofes darauf gründen, dass es sich bei dem Haftungsanspruch um ein Recht handelt, dass akzessorisch zu dem übertragenen Eigentum ist. Mit dem Übergang des Eigentums gehen dementsprechend alle dem Eigentum akzessorischen Rechte und Pflichten auf den Nächsterwerber über. Geht man somit davon aus, dass es sich bei der Haftung des Herstellers gegen den Enderwerber um einen vertraglichen Haftungsanspruch handelt, so muss sich der Enderwerber auch umgekehrt alle Klauseln entgegenhalten lassen, die der Hersteller und der Ersterwerber seinerzeit im Ursprungsvertrag vereinbart hatten; das gilt dann auch für eine Gerichtsstandsklausel. Diese Lösung der vertraglichen Natur der Haftung mag aus deutscher bzw. europäischer Sicht zwar konstruiert oder künstlich erscheinen, der französische Kassationshof hat an dieser Sichtweise jedoch bis vor Kurzem festgehalten.
Am 11. 9. 2013 entschied nunmehr das oberste französische Gericht (C. Cass. Civ. 1ère, 11. 9. 2013, N°09-12.442) im Rahmen des oben dargestellten Rechtsstreits jedoch, dass entgegen der Annahme des Herstellers eine im Ursprungsvertrag vereinbarte Gerichtsstandsklausel keinen Vorrang gegenüber Art. 5 und 6 EuGVVO genießt und der Rechtsstreit insofern auch vor dem Gericht des Ortes anhängig gemacht werden kann, wo die “streitige” Vertragsverpflichtung hätte geleistet werden sollen. Mit dieser Entscheidung folgt der Kassationshof der Lösung, die der EuGH im Vorabentscheidungsverfahren aufgezeigt hat, nämlich dass allein die Tatsache, dass es sich um eine “Vertragskette” handelt, noch nicht ausreicht, um einem Drittem eine Klausel aus der Erstvertrag entgegenhalten zu können, sondern dass es vielmehr der ausdrücklichen Genehmigung dieser Klausel durch den Dritten bedarf, damit dieser daran gebunden ist. Die im vorliegenden Fall vereinbarte Gerichtsstandsklausel zu Gunsten der italienischen Gerichte kann der Versicherung des Enderwerbers folglich nicht entgegengehalten werden, da es an der notwendigen Zustimmung des Enderwerbers fehlte.
Mit dem Urteil, das ein weiteres Mal den Einfluss der Rechtsprechung des EuGH auf die nationalstaatlichen Gerichte veranschaulicht, nähert sich die Cour de Cassation dem europäischen und auch dem deutschen Verständnis der rechtlichen Natur der Produkthaftung an und ermöglicht eine einheitliche Rechtsanwendung sowie Rechtsauslegung im europäischen Raum, die vor allem der Rechtssicherheit im Rahmen von grenzüberschreitenden Lieferverträgen nützt. Problematisch ist die Rechtsprechung allerdings für diejenigen deutschen Hersteller, die ihre Waren nach Frankreich verkaufen und nun die Zuständigkeit der französischen Gerichte vertraglich nicht mehr wirksam ausschließen können.
Judith Adam-Caumeil, Avocat à la Cour/Rechtsanwältin, Paris