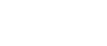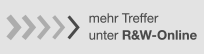“Gateway of India” – erleichterte ausländische Direktinvestitionen in Indien

Die wirtschaftliche Öffnung Indiens wird durch eine überschaubare Rechtsordnung, die durchaus als Standortvorteil gelten kann, unterstützt
“Gateway of India” – so nennt man den Triumphbogen am Hafen von Mumbai, dem früheren Bombay, durch den Generationen junger Engländer Indien betraten, um das Land im Auftrag der britischen Krone zu verwalten. Heute ist Indien Anlaufpunkt international tätiger Unternehmer und Manager, die in der schnell wachsenden indischen Volkswirtschaft große Geschäftschancen sehen.
Erst viele Jahre nach China hat sich Indien gegenüber der internationalen Wirtschaft geöffnet. Nach der Beendigung der Kolonialherrschaft bis zum Beginn der 1990er Jahre verfolgte die indische Regierung eine interventionistische Importsubstitutionspolitik, die Licence Permit Quota Raj, die nahezu jede Art der Geschäftstätigkeit unter einen Genehmigungsvorbehalt stellte. Erst unter der Führung des heutigen Ministerpräsidenten Manmohan Singh gelang die Liberalisierung der Wirtschaft und die Öffnung des Landes für umfangreiche ausländische Direktinvestitionen im Rahmen der reformorientierten New Industrial Policy. Solche Direktinvestitionen sind auch heute noch genehmigungspflichtig; sie können allerdings meistens in einem vereinfachten Genehmigungsverfahren (Automatic Route) erlaubt werden. Mittlerweile ist in vielen Wirtschaftsbereichen die Gründung einer zu 100 Prozent eigenen Tochtergesellschaft ausländischer Unternehmen möglich. Sogar in dem gegen ausländische Konkurrenz besonders geschützten Einzelhandelssektor gibt es seit Kurzem Erleichterungen. Heute ist der direkte Vertrieb von Produkten im indischen Einzelhandel wenigstens im Einmarkenvertrieb (Single Brand Retail) und dort mit 51-prozentiger Beteiligung für Ausländer möglich. Dies ist einer der Gründe für den Boom von Einkaufszentren mit sog. Single Brand Shops.
Eine rechtsvergleichende Untersuchung der wesentlichen wirtschaftlichen Praxisfragen (Podehl/Mathur/Agarwal, Praxishandbuch: Rechtsfragen des Indiengeschäfts, erscheint als RIW-Buch im Herbst 2007) zeigt, dass Indien mittlerweile über eine moderne, liberale Rechtsordnung verfügt, die in neuerer Zeit viele internationale (Rechts-) Standards rezipiert hat, etwa durch völkerrechtliche Verträge unter Führung der Vereinten Nationen und den Beitritt zur WTO. Der schnelle Wandel der indischen Wirtschaftspolitik hat in großen Teilen zu Änderungen des Wirtschaftsrechts geführt. Dies gilt vor allem für die eingangs genannten Regelungen der ausländischen Direktinvestitionen, für das Wettbewerbs- und Kartellrecht sowie für den Schutz des geistigen Eigentums. So wird gerade der überkommene Monopolies and Restrictive Trade Practices Act (1969), durch den liberaleren Competition Act (2002), schrittweise ersetzt. Der Angst von ausländischen Investoren, in Indien Know-how-Verluste zu erleiden, wurde vor allem durch den Beitritt des Landes zu wichtigen internationalen Abkommen wie dem TRIPS-Agreement und die Transformation in nationale Gesetze, z. B. in den Patent Act (2005) begegnet. Eine weitgehende vertragliche Gestaltungsfreiheit garantiert das indische Zivilrecht, das – mit Ausnahme des weiterhin traditionell durch die jeweiligen Religionsgemeinschaften geprägten Familien- und Erbrechts – auf dem englischen Common Law und Gesetzen aus der Zeit des kolonialen British India basiert. Der Kern des Vertrags- und Gesellschaftsrechts ist für den international interessierten europäischen Juristen daher keine gänzliche terra incognita, auch wenn atypische Regelungen, z. B. bei Vertragsstrafen, Wettbewerbsverboten und Formvorschriften, als Fallstricke lauern.
Dagegen hat sich, trotz des hohen Veränderungsdruckes, das indische Arbeitsrecht praktisch seit der Marktliberalisierung nicht weiterentwickelt und verharrt in Unübersichtlichkeit und Überregulierung. Dies liegt wohl an der besonderen Politiknähe des Arbeitsrechts. Versuche, ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch zu schaffen, sind – genauso wie in Deutschland – gescheitert. Ausläufer der ehemals sehr protektionistischen Wirtschaftspolitik finden sich daneben noch in den Schutzvorschriften für indische Partner eines internationalen Joint Ventures sowie bei den Beschränkungen für Ausländer beim Grundstückserwerb. Der Wechsel eines Joint Venture-Partners ist nach wie vor oftmals nur schwer möglich und mit rechtlichen Hürden verbunden. Der Grundstückserwerb ist für nicht in Indien ansässige Ausländer nur über das Vehikel einer indischen Besitzgesellschaft möglich; Ausnahmen gelten für Großinvestoren.
Auch wenn Indien über eine demokratische rechtsstaatliche Verfassung verfügt, die den internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht, besteht bei der Transparenz und Effizienz der Verwaltung erhebliches Verbesserungspotential. In vielen Fällen besteht eine große Diskrepanz zwischen gesetzgeberischem Anspruch und der Rechtswirklichkeit. Beispielsweise ist der Verwaltungsrechtsschutz im Vergleich zu Deutschland erheblich eingeschränkt, und längst nicht alle Akte der Verwaltung sind richterlich überprüfbar. Auch bei der zivilrechtlichen Justizgewährung bestehen erhebliche Mängel, denn Gerichtsverfahren können aufgrund der schwachen personellen Ausstattung der Gerichte durchaus länger als 10 Jahre dauern. Die eigentliche rechtliche Herausforderung für das Indiengeschäft liegt denn auch in einer Streit vermeidenden Vertragspraxis. Insgesamt betrachtet, verfügt Indien jedoch über eine überschaubare Rechtsordnung, die durchaus als Standortvorteil im Vergleich zu zahlreichen anderen Schwellenländern gelten kann.
Rechtsanwalt Dr. Jörg Podehl, Düsseldorf