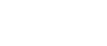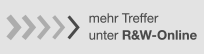Europäisches Arbeitsrecht als Überraschungspaket

Nichts los an der Diskriminierungsfront. Diesen Eindruck vermitteln die ersten Erfahrungsberichte nach einem Jahr AGG (Oberwetter, BB 2007, 1847; Pressemitteilung LAG Baden-Württemberg vom 27. 6. 2007). Die Prozesswelle ist ausgeblieben. Dies liegt aber nicht daran, dass es keine ausreichenden Benachteiligungssachverhalte im Arbeitsrecht geben würde, sondern mehr an der mangelnden Fantasie der beratenden Anwälte, Verbände und Gewerkschaften. Was man mit dem AGG alles machen kann, zeigt ein Verfahren, dessen Ausgang durch die Schlussanträge des Generalanwalts vom 6. 9. 2007 (Rs. C-267/06 – Tadao Maruko/Versorgungsanstalt der Deutschen Bühnen) vorgezeichnet ist. Im dortigen Rechtsstreit beanstandet der Kläger, dass die Versorgungsordnung nur Verheirateten Anspruch auf Witwen- und Witwergeld gewähre, nicht aber dem überlebenden Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Der Generalanwalt schlägt dem Gerichtshof u. a. vor anzuerkennen, dass eine mittelbare Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung vorliegt, wenn eine Versorgungsordnung mangels einer Eheschließung, die nur Personen verschiedenen Geschlechts vorbehalten ist, solche Personen ausschließt, die eine Verbindung eingehen, die mit einer Ehe im Wesentlichen identisch ist. Er überlässt es den nationalen Gerichten zu prüfen, ob die Rechtstellung von Ehegatten mit derjenigen von Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gleichartig ist.
Darin liegt Sprengstoff. Noch judizieren die Gerichte auf der Grundlage eines traditionellen Verständnisses. Der Bundesfinanzhof verweigert den Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft einen Anspruch auf Durchführung einer Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer unter Anwendung des Splittingtarifs. Das Bundesverwaltungsgericht gewährt dem in einer Lebenspartnerschaft lebenden Beamten keinen Anspruch auf den Familienzuschlag und akzeptiert, dass die Satzung eines Versorgungswerks die Hinterbliebenenversorgung auf Witwen und Witwer beschränkt. Wir werden uns auf dieses traditionelle Denken der obersten Gerichte nicht verlassen dürfen, wenn der EuGH im Sinne der Schlussanträge des Generalanwalts judiziert. Hier findet sich ein neues großartiges Betätigungsfeld für die im Arbeitsrecht versierten Anwälte. Aber nicht nur das. Der Fall zeigt, dass traditionelle rechtliche Betrachtungen gefährdet sind, wenn nur der EuGH die Möglichkeit erhält, Inhalt und Tragweite der europäischen Richtlinien zu definieren. Es gibt neben der Ehe weitere, vermeintlich sichere Bastionen, die möglicherweise vom EuGH nicht in der gleichen Weise respektiert werden wie durch die – zementierte – nationale Rechtsprechung. Ich denke hierbei an die Rechtsprechung zur Anwendung der Vorgaben des kollektiven Arbeitsrechts auf kirchliche Einrichtungen und zu den Wirkungen des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts im Individualarbeitsrecht.
Es gehört eine gehörige Portion Mut dazu, die gefestigten Regelungen zum Kirchenarbeitsrecht mit dem Benachteiligungsverbot zu verknüpfen. Aber auch dies ist so wenig erfolglos wie der Kampf der Lesben und Schwulen gegen die tradierte Rechtsprechung zu den Wirkungen einer Ehe.
Es ist deshalb nicht nur das Diskriminierungsmerkmal Alter, welches bislang als die zentrale Problematik des AGG identifiziert worden ist, in den Fokus zu rücken. Zugegebenermaßen sind eine Reihe arbeitsrechtlicher Selbstverständlichkeiten heute anders zu beurteilen, weil die Altersdifferenzierung schwieriger geworden ist. Wer heute noch auf die Berechnung der Kündigungsfristen unter Beachtung von § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB vertraut, dürfte schlecht beraten sein. Im Gegensatz hierzu hat der EuGH im Verfahren Palacios de la Villa (RIW 2007, 941 [in diesem Heft]) das Vertrauen in die Wirksamkeit tarifvertraglicher Rentenaltersgrenzen mit Urteil vom 16. 10. 2007 (wieder)hergestellt. Wer hätte gedacht, dass vom Kündigungsverbot des § 9 MuSchG nicht nur die Kündigung innerhalb der Schutzfrist erfasst wird, sondern auch die Entscheidung des Arbeitgebers, der Arbeitnehmerin nach Ende der Schutzfrist zu kündigen (Paquay-Urteil vom 11. 10. 2007, Rs. C-460/06)?
Es lohnt sich deshalb, im Dickicht der europäischen Verträge, Verordnungen und Richtlinien zu stöbern und diese Vorschriften für das nationale Recht fruchtbar zu machen. Der EuGH und zwischenzeitlich auch das Bundesarbeitsgericht ermuntern uns hierzu in geradezu vorbildlicher Weise. In der Pfeiffer-Entscheidung (EuGH, RIW 2005, 54) gibt der EuGH den nationalen Gerichten auf, das innerstaatliche Recht soweit wie möglich anhand der Richtlinie auszulegen. Infolge der Mangold-Entscheidung (EuGH, RIW 2006, 52) wurde die Unanwendbarkeit einer nationalen Norm, die mit einer Richtlinie unvereinbar ist, anerkannt. Wer auf diesem sicheren Fundament der europäischen Rechtsprechung auf den Bestand nationaler Normen vertraut und diese nationalen Normen nicht auf den Prüfstand des europäischen Denkens stellt, ist selbst schuld.
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeitsrecht Professor Dr. Stefan Nägele, Stuttgart