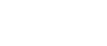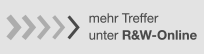Europäische Kommission und Arbeitsrechtsvergleichung

Der Rauch der Schlacht um das Grünbuch der Kommission zur Modernisierung des Arbeitsrechts hat sich verzogen, und die Gemüter haben sich beruhigt nach der Ankündigung der Kommission, auf das von ihr eingeleitete Konsultationsverfahren hin – vorerst – keine gesetzgeberischen Maßnahmen ergreifen zu wollen. Zu einer europaweiten generellen Definition des Arbeitnehmerbegriffs wird es somit nicht kommen, und schon gar nicht ist mit umfassenden gesetzgeberischen Initiativen im Bereich des Individualarbeitsrechts zu rechnen. Zwar hat sich die Kommission zuletzt immer wieder darum bemüht, dem Begriff der “Flexicurity” schärfere Konturen zu verleihen. Damit hat sie insbesondere auch die Sozialpartner zum Nachdenken animiert. Danach, dass es alsbald zu Richtlinien-Vorschlägen kommen könnte, aus denen sich Näheres ergibt, sieht es indes derzeit nicht aus.Ist also nichts Neues aus Brüssel zu erwarten? Das wäre dann doch zu viel gesagt. So sorgte die Kommission vor kurzem dadurch für Aufmerksamkeit, dass sie gegenüber einer Reihe von Mitgliedstaaten Defizite bei der Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinien angemahnt hat. Die Bundesregierung hat diesbezüglich gar einen “blauen Brief” erhalten. In gesetzgeberischer Hinsicht steht demgegenüber derzeit zwar nur eine Novellierung der Richtlinie über Europäische Betriebsräte fest auf dem Arbeitsplan der Kommission. Doch geht es dabei – auch wirtschaftlich betrachtet – durchaus nicht um Kleinigkeiten. So ist eine Herabsetzung der Schwellenwerte für die Anwendung der Richtlinie ebenso im Gespräch wie eine Verstärkung der Rolle, die die Gewerkschaften im Rahmen der entsprechenden Informations- und Konsultationsprozesse spielen. Auch über die Nichtverlängerung von sog. Art. 13-Vereinbarungen und über eine Ausdehnung der Gegenstände, über die der Europäische Betriebsrat informiert und zu denen er konsultiert werden muss, wird derzeit nachgedacht.
Überdies scheinen – diesseits gesetzgeberischer Aktivitäten – Themenfelder auf, mit denen sich die Kommission in naher Zukunft beschäftigen wird. Dazu gehören z. B. Fragen, die sich im Zusammenhang mit Unternehmensumstrukturierungen ergeben. Und auch die Problematik transnationaler Kollektivverträge bildet einen Themenbereich, dessen sich die Kommission weiter annehmen will.
Von alledem abgesehen schickt sich die Kommission an, näher auf die Arbeitsrechtsordnungen der Mitgliedstaaten zu schauen. Dabei geht es nicht allein darum, mögliche Umsetzungsdefizite früher als bislang zu erkennen. Vielmehr soll die Kommission auch in die Lage versetzt werden, ggf. Impulse aus den Mitgliedstaaten aufzunehmen und in die eigene Arbeit einfließen zu lassen. Die gegenseitige Kenntnis soll vergrößert und der Dialog zwischen den Beteiligten intensiviert werden. Mit dieser Zielsetzung hat sich die Kommission vor kurzem der Unterstützung durch ein arbeitsrechtliches Expertennetzwerk versichert, dessen Mitglieder alle Mitgliedstaaten der EU (sowie die dem Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Staaten, also Island, Liechtenstein und Norwegen) repräsentieren. Das Netzwerk hat am 1. 1. 2008 seine Arbeit aufgenommen.
Mit dieser Zusammenarbeit von Kommission und europäischer Arbeitsrechtswissenschaft wird ein dringend notwendiger Schritt gemacht: Die Arbeitsrechtsvergleichung erhält endlich einen größeren Stellenwert. Immerhin hat die Kommission schon im Grünbuch vereinzelt auf Vorbilder aus dem Ausland verwiesen, auf das Abfindungssystem im österreichischen Kündigungsschutzrecht etwa, aber z. B. auch auf differenzierte Regelungen zum Anwendungsbereich arbeitsrechtlicher Vorschriften im Vereinigten Königreich. In Zukunft wird man indes systematischer an die sich stellenden rechtsvergleichenden Aufgaben herangehen. Das Gespräch zwischen den Akteuren des europäischen Arbeitsrechts kann davon nur profitieren.
Professor Dr. Bernd Waas, Hagen, und Professor Dr. Guus Heerma van Voss, Leiden