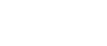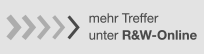Im Blickpunkt

Bundesfinanzminister Klingbeil ließ aufhorchen, als er im “Berlin direkt” ZDF-Sommerinterview äußerte, dass höhere Steuern für Spitzenverdiener und Vermögende die Finanzlücken im Bundeshaushalt schließen sollen. Aus seiner Sicht müssten sich Menschen mit hohem Einkommen und hohem Vermögen fragen lassen, welchen Teil sie dazu beitrügen, damit es insgesamt gerechter werde. Dies sei schon immer die Position der SPD gewesen. “Diese Grundüberzeugung gebe ich ja nicht auf mit Eintritt in die Koalition”, so Klingbeil weiter. Zu schließen sei die Lücke von 30 Mrd. Euro im Haushalt 2027. In diesem Zusammenhang stellen sich mehrere Fragen. Wer ist vermögend, wer ist Spitzenverdiener und wie groß muss der Kreis gezogen werden, damit die 30 Mrd. zusammenkommen? Nähern wir uns zunächst den Spitzenverdienern. Bekanntermaßen existiert kein einheitlicher Begriff. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. (IW) sieht in der Gruppe der Alleinstehenden für das Jahr 2022 diejenigen mit einem Nettogehalt von über 5 780 Euro im Monat als einkommensreich an. Bei Paaren ohne Kinder sieht es die Grenze bei 8 670 Euro und bei einem Paarhaushalt mit zwei Kindern unter 14 Jahren ist ein monatliches Nettoeinkommen von 12 140 Euro notwendig (IW-Kurzbericht 29/2024 vom 25.3.2025, S. 2). Ein Blick in die Statistik des Einkommensteueraufkommens (destatis) für 2021 zeigt, dass 134 200 Steuerpflichtige die sog. Reichensteuer (45 %) zu zahlen haben. Bezogen auf alle Steuerpflichtigen sind dies 0,3 %. Diese 0,3 % tragen 22,2 % der gesamten Einkommensteuer. Die Fortschreibung des BMF kommt für 2025 zu dem Ergebnis, dass diese Personengruppe im Jahr 2025 23,6 % der gesamten Einkommensteuer zahlt. Damit wird deutlich, dass diese zahlenmäßig geringe Gruppe wohl kaum allein das Haushaltsloch stopfen kann. Es wird daher wohl mehr Steuerpflichtige treffen müssen, damit betragsmäßig nennenswerte Einnahmen erzielt werden. Ob sich diese Betroffenen zu den Spitzenverdienern zählen, darf bezweifelt werden. Hier suggeriert die Politik, dass ganz wenige betroffen sein sollen. Die Realität sieht dann anders aus.
Prof. Dr. Michael Stahlschmidt, Ressortleiter Steuerrecht