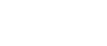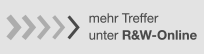Im Blickpunkt

Mit Urteil vom 5.5.2020 – 2 BvR 859/15 u. a. – hat der Zweite Senat des BVerfG mehreren Verfassungsbeschwerden gegen das Staatsanleihekaufprogramm (Public Sector Purchase Programme – PSPP) stattgegeben (s. hierzu auch die Leitsätze des BVerfG unten auf dieser Seite). Danach haben Bundesregierung und Deutscher Bundestag die Beschwerdeführer in ihrem Recht aus Art. 38 Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG verletzt, indem sie es unterlassen haben, dagegen vorzugehen, dass die EZB in den für die Einführung und Durchführung des PSPP erlassenen Beschlüssen weder geprüft noch dargelegt hat, dass die hierbei getroffenen Maßnahmen verhältnismäßig sind. Dem stehe das Urteil des EuGH vom 11.12.2018 nicht entgegen, da es im Hinblick auf die Kontrolle der Verhältnismäßigkeit der zur Durchführung des PSPP erlassenen Beschlüsse schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar und damit ebenfalls ultra vires ergangen sei (PM BVerfG Nr. 32/2020 vom 5.5.2020). Nach Ansicht von Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, rüttelt die Entscheidung “nicht an den Grundfesten der Währungsunion” (s. PM BdB vom 5.5.2020). Wichtig sei, dass das BVerfG festgestellt habe, dass es sich bei den Staatsanleihekäufen der EZB nicht um verbotene Staatsfinanzierung handele. Die vom Gericht insbesondere geforderte Abwägung zwischen dem währungspolitischen Ziel und wirtschaftspolitischen Konsequenzen sei bedeutsam, aber erfüllbar. Die europäischen Währungshüter hätten alle Möglichkeiten nachzusteuern. Demgegenüber bekräftigte der Chefsprecher der EU-Kommission, Eric Manner, ungeachtet einer Analyse der Einzelheiten der BVerfG-Entscheidung den Vorrang des EU-Rechts und die Tatsache, dass die Urteile des EuGH für alle nationalen Gerichte bindend seien (s. EU-Aktuell vom 5.5.2020).
Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht