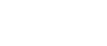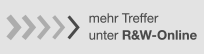Erosionen des Mindeststammkapitals?*
Matthias Casper**
Honorabilis, Spektabilität, verehrte Familie Ulmer, liebe Frau Nast-Kolb, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler von Peter Ulmer, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren,
wer durch die Schule von Peter Ulmer gegangen ist, dem viele hier im Raum so unendlich viel zu verdanken haben, hatte es zwar nicht immer ganz einfach, aber dafür war der Ertrag – oder wie man neudeutsch sagt – das Take-away umso größer. Eine Gewissheit, die wir alle mitgenommen haben, ist die Überzeugung, dass das Mindeststammkapital einer Kapitalgesellschaft eine sinnvolle Errungenschaft ist, die es gegen Angriffe robust zu verteidigen gilt. Sachgründungen wurden kritisch beäugt, der Umgehung der Sachgründungsvorschriften galt es durch anspruchsvolle Dogmatik zu begegnen. Die Kommentierungen der Kapitalaufbringungsvorschriften von Ulmer legen hiervon ein beeindruckendes Zeugnis ab.1
Ich möchte heute nicht abermals über das viel diskutierte Für und Wider eines Mindeststammkapitals sprechen.2 Nur für die Nichtjuristen im Raum sei der Hinweis erlaubt, dass es unter Gesellschaftsrechtlern mehrheitlich und unter Schülern von Ulmer wohl sogar einhellig für sinnvoll erachtet wird, dass bei der Gründung einer Kapitalgesellschaft je nach Rechtsform zwischen 25.000 und 120.000 Euro aufgebracht werden müssen. Wirtschaftet die Gesellschaft schlecht, ist dieses Mindestkapital zwar schnell aufgebraucht; indes bildet es einen Puffer bei entstehenden Verlusten3 und noch viel wichtiger, es stellt eine gewisse Seriositätsschwelle dar und hält somit allzu hasardeurische Gründer davon ab, eine Kapitalgesellschaft zu gründen und damit Haftungsrisiken auf die Gläubiger zu externalisieren4.
Auch möchte ich nicht über die von Peter Ulmer sehr kritisch beäugte Neuregelung der verdeckten Sacheinlage durch das MoMiG sprechen.5 Sondern ich möchte zwei Themen exemplarisch herausgreifen, mit denen ich mich jüngst für die Kommentierung im Großkommentar zum GmbH-Gesetz (für mich immer noch der Ulmer/Habersack, wenn nicht sogar der Hachenburg) beschäftigt habe.6
Zum einen soll es um eine Bewertung der ebenfalls durch das MoMiG eingeführten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) und zum anderen um die in jüngerer Zeit immer beliebter werdende Bareinlage mit einem Sachagio gehen. Beide Themen könnte man als eine Erosion des Mindeststammkapitals betrachten. Ziel meines Vortrages ist es allerdings zu zeigen, dass kein Grund besteht, die Flinte resignierend ins Korn zu werfen, sofern man an der einen oder anderen Stelle nur die Stellschrauben richtig justiert.
Ich werde im Folgenden in vier Schritten vorgehen:
1. Anhand einiger Rechtstatsachen möchte ich untersuchen, ob der Gesetzgeber mit der Schaffung der stammkapitallosen UG sein intendiertes Ziel erreicht hat.
2. Im zweiten Schritt werde ich einige wenige Anwendungsprobleme der UG skizzieren und nach Stellschrauben Ausschau halten, die ggf. nachjustiert werden müssen.
3. Der dritte Teil wird die Kombination aus Bareinlage und Sachagio analysieren. Handelt es sich insoweit um eine unzulässige Erosion des Stammkapitals?
4. Der vierte Schritt wird eine Symbiose beider Teilthemen sein. Es wird zu klären sein, ob diese Kombination trotz des Sacheinlageverbots auch bei der Unternehmergesellschaft möglich ist.
Der Vortrag beschränkt sich wegen § 36a Abs. 2 S. 3 AktG auf die GmbH.
I. Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) eine legislatorische Erfolgsgeschichte?
Beginnen wir also mit der Frage, ob die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) eine legislatorische Erfolgsgeschichte darstellt. Für diejenigen im Raum, die mit dem Gesellschaftsrecht nicht mehr so vertraut sind, sei in Erinnerung gerufen, dass die mit dem MoMiG am 1. 11. 2008 – also vor fast genau 16 Jahren – geschaffene Unternehmergesellschaft praktisch kein Mindest-
Bei ihrer Einführung war der Aufschrei groß.7 UG, so wurde behauptet, stehe in Wirklichkeit für Untergeschoss oder gar für Unter Geiern bzw. Gangstern.8
Der Gesetzgeber hat die Einführung dieser Rechtsformvariante der GmbH damit begründet, dass nur so die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der GmbH angesichts einer massiven Einwanderungswelle stammkapitalloser Limiteds aus dem Vereinigten Königreich gesichert werden kann.9 Was war passiert? Nachdem der EuGH Anfang der 2000er Jahre in mehreren Entscheidungen faktisch die Gründungstheorie in der EU anerkannt hatte,10 konnte man sehr einfach eine Limited ohne Stammkapital gründen und deren Verwaltungssitz an nächsten Tag nach Deutschland verlegen, wo die Limited als rechtsfähige Kapitalgesellschaft anzuerkennen war. Es gab sogar eine Internetseite mit der Domain Tschuess-Deutschland.de, mit der sich die Gründung sehr einfach ohne Reise ins Vereinigte Königreich erledigen ließ.11 Schätzungen zufolge sind zwischen 2003 und 2008 zwischen 20.000 und 60.000 Limiteds nach Deutschland eingewandert.12 Diesen Trend wollte der deutsche Gesetzgeber stoppen, auch wenn diese Einwanderungswelle im Jahr 2008 vermutlich schon wieder rückläufig war.13
Zur Bewertung der Frage, ob diese Intention des Gesetzgebers aufgegangen ist, lohnt ein Blick auf die Rechtstatsachen.14
Betrachtet man zunächst die absoluten Zahlen, kann man feststellen, dass die UG bereits Anfang 2014 die Schallmauer von 100.000 Gesellschaften bundesweit durchbrach.15 2023 waren es fast 200.000 Gesellschaften,16 sodass die
Existierten 2008 noch weit über 20.000 Auslandsgesellschaften mit Verwaltungssitz in Deutschland,20 ist diese Zahl schnell zurückgegangen. Im Zeitraum von 2013 bis 2023 sind über 50 % der Anfang 2013 noch gezählten 13.800 Gesellschaften verschwunden,21 aktuell sind es noch 6.246,22 wovon nach Schätzungen trotz des Brexits immer noch knapp die Hälfte UK-Limiteds sind,23 die vermutlich so inaktiv sind, dass sie nicht mal gelöscht worden sind. Das Verhältnis von Auslandsgesellschaften zur Unternehmergesellschaft beträgt aktuell 1:31, Tendenz weiter sinkend. Damit zeigt sich, dass – betrachtet man die absoluten Zahlen – die UG den Auslandgesellschaften im Allgemeinen und der UK-Limited im Besonderen den Rang abgelaufen hat, die Rechnung des Gesetzgebers von 2008 also aufgegangen ist.
Doch wie hoch ist der Preis hierfür, wie viele Unternehmergesellschaften etablieren sich langfristig am Markt und erreichen irgendwann das Stadium ei-
II. Anwendungsproblem der UG
Ich komme zu meinem zweiten Schritt. Gegen die These, dass die UG eine Erfolgsgeschichte ist, könnte hingegen sprechen, dass wir uns eine Vielzahl von Rechtsproblemen mit der Anwendung des § 5a GmbHG eingefangen haben. Ökonomen würden insoweit von hohen legislativ bedingten Transaktionskosten sprechen.
Im Stakkato werde ich einige Anwendungsprobleme herausgreifen und möglichen Reformbedarf in den Mittelpunkt stellen.
Der schlichte Satz in § 5a Abs. 2 S. 2 GmbHG, wonach “Sacheinlagen . . . ausgeschlossen [sind]”, hat mehr Probleme bereitet als erwartet.34
Schließt dieses Sacheinlageverbot die Anwendung der Regelungen über die verdeckte Sacheinlage und somit die Privilegierung durch die Anrechnungslösung aus? Peter Ulmer hat sich in einem Beitrag zu Ehren von Marcus Lutter anlässlich dessen 80. Geburtstag in der GmbH-Rundschau 2010 nochmals klar positioniert.35 Der Gesetzgeber würde sich wertungswidersprüchlich verhalten, wenn er – hätte er die streitige Frage erkannt – die Sacheinlage bei der UG komplett verboten, das in § 19 Abs. 4 GmbHG enthaltene “Umgehungsprivileg” aber für anwendbar erklärt hätte.36 Demgegenüber hält die inzwischen wohl überwiegende Auffassung37 die durch eine fehlende Anwendung
Andreas Pentz und ich – obgleich treue Ulmer-Schüler – neigen der Gegenauffassung zu, da § 19 Abs. 4 GmbHG kein Umgehungsprivileg beinhaltet.41 Die Debatte muss indes nicht erneut geführt werden. Für die Evaluation der UG als solche können wir festhalten, dass das Sacheinlageverbot auf der rechtspolitischen Checkliste stehen sollte. Nur als Fußnote sei erwähnt, dass diese Frage, um die dogmatisch so anspruchsvoll gerungen wird, die Rechtsprechung bisher nie erreicht hat, da die Streitwerte in der Regel so gering sind, dass es oft nicht einmal für die Zuständigkeit des Landgerichts genügt.42
Das Sacheinlageverbot in § 5a Abs. 2 S. 2 GmbHG sorgt aber auch an anderer Stelle für Schwierigkeiten. Unter Rückgriff auf eine strenge Wortlautauslegung des § 56 GmbHG, der nicht auf das Sacheinlageverbot verweist, könnte man die These vertreten, dass dieses nur in der Gründungsphase gilt.43 Insoweit bin ich mit Peter Ulmer einig,44 dass eine derartige Sichtweise zu kurz greift.45 Der Umgehung wäre Tür und Tor geöffnet, wenn die Gesellschafter der UG mit je einem Euro Stammkapital pro Einlage am Tag nach ihrer Eintragung daherkommen könnten und nun zwei gebrauchte Kraftfahrzeuge im Wert von je 10.000 Euro einlegen könnten. Ulmer wollte anders als die heute wohl überwiegende Auffassung die Analogie des Sacheinlageverbots auch dann anwenden, wenn die UG durch die Sachkapitalerhöhung zur Voll-GmbH mutiert, was indes das erklärte Ziel des § 5a Abs. 3, 5 GmbHG ist.46 Aufgrund dieses transitorischen Charakters der UG sprechen gute Gründe dafür, an dieser Stelle weniger streng zu sein, denn die GmbH könnte ebenfalls im Wege der Sachgründung entstehen, sodass keine Erosion des Mindestkapitals droht.47
Damit kommen wir dann auch schon zu einem wichtigen Webfehler der UG. Nach der derzeitigen Konzeption des Gesetzes besteht kein Zwang, die UG durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in eine reguläre GmbH zu überführen, wenn die zu bildende Gewinnrücklage den erforderlichen Betrag erreicht hat.48 Es besteht aber kein Grund dafür, dass die Gesellschafter die UG als solche weiterführen können, wenn die Gewinnrücklage in einer Höhe angespart ist, dass der Wechselbalg, um Ulrich Noack zu zitieren,49 in eine GmbH überführt werden kann. Meinem rechtspolitischen Petitum für eine Zwangsumwandlung steht auch nicht entgegen, dass die Unternehmergesellschaft in anderen Fällen, in denen kein ausreichender Gewinn wie bei gUG
Die Liste der Anwendungsprobleme ließe sich fortsetzen. Indes zeigt sich, dass die Probleme nicht über das übliche Maß hinausgehen. Der Ansatz des MoMiG hat sich im Wesentlichen bewährt.52 Bei einer Reform könnte man über eine Aufgabe des Sacheinlageverbots nachdenken, denn dafür streitet vor allem der Aspekt der Verfahrensbeschleunigung. Hält man daran fest, sollte man seine grundsätzliche Anwendbarkeit bei der Kapitalerhöhung – vorbehaltlich von § 5a Abs. 5 GmbHG – klarstellen, entsprechendes gilt für die zu bejahende Anwendbarkeit des § 19 Abs. 4 GmbHG.
Abschließend sei noch ein kurzer Hinweis zum zwingenden Rechtsformzusatz UG (haftungsbeschränkt) erlaubt. Rechtspolitischen Forderungen nach einer Vereinfachung wie UG mbH oder schlicht UG53 ist eine klare Absage zu erteilen.54 Dem Rechtsformzusatz kommt eine sinnvolle Warnfunktion gegenüber den Gläubigern zu. Gerade auch seine Schwerfälligkeit mit dem Klammerzusatz ist der Preis, den Gesellschafter für den Verzicht auf das Mindeststammkapital zu zahlen haben.
III. Bareinlage mit Sachagio
Mit dem dritten Akt meines Vortrages wechselt das Bühnenbild. Wir verlassen die Unternehmergesellschaft, zumindest vorläufig, und wenden uns mit der Bareinlage unter Einschluss eines Sachagios einer übergreifenden Fragestellung zu, die man ebenfalls als Erosion des Stammkapitals betrachten könnte.
Worum geht es? Lassen Sie mich als Teaser für den dritten Akt einen Fall des Oberlandesgerichts schildern, das für den hiesigen Gerichtssprengel in zweiter Instanz zuständig ist, also das OLG Karlsruhe.55 Einzelkaufmann A gründete zunächst eine GmbH. Diese führte sodann eine Kapitalerhöhung über 100 Euro durch, wobei verabredet wurde, dass A auf seine Bareinlage als
Es stellen sich drei Fragen: Erstens, liegt hierin eine unzulässige Umgehung der Vorschriften über die Sacheinlage oder eine verdeckte Sacheinlage. Zweitens, bedarf das Sachagio einer Werthaltigkeitsprüfung durch das Registergericht. Drittens, bedarf es einer Versicherung, dass das eingelegte Unternehmen oder das sonstige Sachagio keinen negativen Wert aufweist.
Eine Umgehung der Sacheinlagevorschriften liegt meines Erachtens eher fern.56 Denn für das Agio, das Aufgeld, wird gerade kein Mitgliedschaftsrecht gewährt und zwar unabhängig davon, ob es sich um ein korporationsrechtliches oder bloß schuldrechtliches Agio handelt. Der Rechtsverkehr wird auch nicht in die Irre geführt. Es wird eine zusätzliche Einlage von 100 Euro versprochen und nach außen dokumentiert, diese wird auch erbracht. Dass der Inferent eine zusätzliche Leistung als Aufgeld erbringt, ist so lange unproblematisch, wie das Sachagio werthaltig ist. Der Gesellschaft fließt also ein zusätzlicher Wert zu. Eine verdeckte Sacheinlage liegt ebenfalls nicht vor, denn es fehlt regelmäßig an einer Verdeckung.57 Für den Fall, dass ein Unternehmen eingelegt wird, wird jedoch vorgeschlagen, dass die damit verbundene Übernahme der Schulden des eingelegten Unternehmens durch die GmbH einer verdeckten Sacheinlage gleichkäme.58 Solange das als Sachagio eingelegte Unternehmen werthaltig ist und die Verbindlichkeiten aus seinen Erträgen erwirtschaftet werden, scheint mir dies jedoch nicht zwingend.59 Zudem handelt es sich bei der Übernahme der Schulden des Unternehmens um eine dem Sachagio anhaftende Folge, nicht hingegen um die Vergütung aus einem verdeckten
Nachdem geklärt ist, dass eine Bareinlage mit Sachagio grundsätzlich zulässig ist, bleibt die zweite Frage zu erörtern, ob nicht zumindest bei der Einlage eines Unternehmens gleichwohl eine Werthaltigkeitsprüfung durch das Registergericht vorzunehmen ist.63 Hierfür könnte eine Analogie zu § 36a Abs. 2 S. 3 AktG streiten. Eine derartige Analogie lehnt die h.M. indes mit Recht ab.64 Denn aus § 9c Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 S. 1 GmbHG ergibt sich unzweideutig, dass bei der Anmeldung der Gesellschaft nur die Mindesteinzahlung auf den Nennbetrag der Geschäftsanteile nachgewiesen werden muss. Aus der Wendung in § 7 Abs. 2 S. 1 GmbHG “soweit nicht Sacheinlagen vereinbart sind” ergibt sich nichts anderes. Diese Formulierung bringt nur zum Ausdruck, dass bei einer Sacheinlage wegen § 7 Abs. 3 GmbHG die gesamte vor Eintragung zu erbringende Einlage der Werthaltigkeitsprüfung unterliegt, adressiert das Agio aber gerade nicht.65
Deshalb ist drittens und abschließend der Fall zu betrachten, wie der Gefahr eines negativen Wertzuflusses z.B. durch Einbringung eines überschuldeten Unternehmens im Wege eines Sachagios begegnet werden kann. Um der Gefahr zu begegnen, dass das Agio die Bareinlage oder das vorhandene Stammkapital in Mitleidenschaft zieht, wird verbreitet ein positiver Wertnachweis über das eingebrachte Unternehmen verlangt.66 Dabei handelt es sich um einen Nachweis, dass das Aktivvermögen des eingebrachten Unternehmens
Weist das Sachagio entgegen der Versicherung bzw. des Nachweises doch einen negativen Wert auf, haftet der Inferent analog § 9 Abs. 1 S. 1 GmbHG auf die Wertdifferenz, der Versichernde zudem als Gesamtschuldner nach § 9a Abs. 1 GmbHG.71
Auch bei der Bareinlage mit Sachagio kommt es also darauf an, dass man die Stellschrauben an der richtigen Stelle justiert. So lässt sich auch hier einer Erosion des Stammkapitals begegnen, ohne dass man gleich mit einem vollständigen Verbot daherkommen muss.
IV. UG und Bareinlage mit Sachagio
Ob die UG trotz des Sacheinlageverbotes ebenfalls ein Sachagio bei einer Bareinlage wählen kann, wird nur gelegentlich diskutiert, dann aber mit Recht unisono bejaht.72 Soweit nicht im Einzelfall eine verdeckte Sacheinlage vorliegt, sind keine Gründe dafür ersichtlich, die UG anders als die reguläre
Akzeptiert man weiter, dass die gegründete UG auch eine Sachkapitalerhöhung in die GmbH vollziehen kann,74 kann sich aber ein Umgehungsproblem stellen und zwar in solchen Fällen, in denen die UG quasi nur kurzfristig zwischengeschaltet wird, um die Werthaltigkeitskontrolle bei der Sachgründung einer GmbH zu vermeiden.75 Wenn beispielsweise eine UG mit einem Euro Bareinlage gegründet wird, die mit einem Sachagio ausgestattet ist, dessen Wert 25.000 Euro oder mehr aufweist, um diese Kapitalrücklage dann alsbald zu einer Transformation der UG in eine GmbH nach § 5a Abs. 5 GmbHG zu benutzen, wird man das Registergericht für berechtigt, wie für verpflichtet halten müssen, die Werthaltigkeit des Sachagios, das nun praktisch das gesamte Stammkapital der GmbH ausmacht, anhand eines von den Gesellschaftern zu erstellenden Sachgründungsberichts zu überprüfen.
V. Zusammenfassung
Ich komme zum Schluss. Das Mindeststammkapital hat eine wichtige Funktion. Im Interesse des Gläubigerschutzes ist es vor Erosionen zu schützen. Gleichwohl hat sich die Einführung der Unternehmergesellschaft in der Retrospektive bewährt. Nur so konnte der deutsche Gesetzgeber das Stammkapital als Errungenschaft des deutschen Rechts langfristig vor Erosionen infolge des unkontrollierten Zuzugs ausländischer Gesellschaften schützen. Das Sacheinlageverbot bei der UG hätte es hierfür nicht zwingend bedurft. Wichtiger ist es vielmehr, den transitorischen Charakter der UG zu stärken. Auch der Barleinlage mit kombiniertem Sachagio ist mit Augenmaß zu begegnen.
| * | Die Vortragsform wurde durchweg beibehalten und lediglich um exemplarische Fußnoten ergänzt und an wenigen Stellen etwas ausführlicher gefasst. |
| ** | Dr. iur., Prof., Dipl.-Oec., Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrecht, Direktor des Instituts für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht an der Universität Münster. |
| 1 | Vgl. nur Ulmer/Habersack/Winter/Ulmer, GroßkommGmbHG, 1. Aufl. 2005, § 5 Rdn. 9 ff., 24 ff., § 19 Rdn. 85 ff. sowie zuvor Hachenburg/Ulmer, GroßkommGmbHG, 8. Aufl. 1989/1990, § 5 Rdn. 6 ff., 19 ff., § 19 Rdn. 76 ff. |
| 2 | Vgl. dazu etwa C. Lieder, Moderner Kapitalschutz, 2018, S. 65 ff. |
| 3 | Habersack/Casper/Löbbe/Ulmer/Casper, GroßkommGmbHG, 3. Aufl. 2019, § 5 Rdn. 13 ff. |
| 4 | Habersack/Casper/Löbbe/Ulmer/Casper (Fn. 3), § 5 Rdn. 15. |
| 5 | Die ursprüngliche Erfüllungslösung im Regierungsentwurf zum Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) hatte in Ulmers Augen mit Recht keine Gnade verdient, vgl. Ulmer, Der “Federstrich des Gesetzgebers” und die Anforderungen der Rechtsdogmatik, ZIP 2008, 45, 50 ff. |
| 6 | Habersack/Casper/Löbbe/Casper, GroßkommGmbHG, 4. Aufl. 2025, § 5 Rdn. 190 ff.; § 5a Rdn. 9–18, 48–54. |
| 7 | Vgl. etwa Heckschen, DStR 2007, 1442, 1446; Römermann, GmbHR 2007, R193; Bormann, GmbHR 2007, 897, 899; Schärtl, GmbHR 2007, R305 f.; Freitag/Riemenschneider ZIP 2007, 1485, 1491 f. |
| 8 | Vgl. die Nachweise bei Ulmer/Habersack/Winter/Paura, GroßkommGmbHG, Erg.-Bd. , 1. Aufl. 2009, § 5a Rdn. 5, der sich diese Zuschreibungen allerdings nicht zu eigen machte. |
| 9 | RegE MoMiG BT-Drs. 16/6140, S. 25. |
| 10 | EuGH v. 9. 3. 1999, Rs. C-212/97 (Centros), NJW 1999, 2027; EuGH v. 5. 11. 2002, Rs. C-208/00 (Überseering), NJW 2002, 3614; EuGH v. 30. 9. 2003, Rs. C-167/01 (Inspire Art), NJW 2003, 3331. |
| 11 | Ulmer/Habersack/Winter/Paura (Fn. 8), § 5a Rdn. 1. |
| 12 | Vgl. die unterschiedlichen Darstellungen bei Weber, BB 2009, 842; Westhoff, GmbHR 2007, 474, 478 f.: 46.000 am 1. 11. 2006; Miras, Die neue Unternehmergesellschaft, 1. Aufl. 2008, Rdn. 98. |
| 13 | Niemeier, ZIP 2007, 1794, 1796 ff. |
| 14 | Details bei Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 9 ff. |
| 15 | MünchKommGmbHG/Rieder, 4. Aufl. 2022, § 5a Rdn. 5. |
| 16 | Bayer/J. Lieder/Hoffmann, GmbHR 2023, 709, 715 (Rdn. 13, 15). |
| 17 | Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 13. |
| 18 | Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 13. |
| 19 | Den Hinweis auf die Gewerbezahlen verdanke ich Wilhelm Niemeier im Nachgang zu der Veranstaltung. Sie sind monatsweise unter https://www.statistischebibliothek.de abrufbar. Eine Detailanalyse dieser Daten konnte auf die Schnelle nicht geleistet werden, zumal es keine Jahresberichte gibt. |
| 20 | Vgl. oben Fn. 12 sowie zusammenfassend Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 9, 14; Bayer/Hoffmann, GmbHR 2018, 1156, 1159. |
| 21 | Bayer/J. Lieder/Hoffmann, GmbHR 2023, 709, 717 (Rdn. 22). |
| 22 | Bayer/J. Lieder/Hoffmann, GmbHR 2023, 709, 717 (Rdn. 21–23). |
| 23 | In Anlehnung an Bayer/J. Lieder/Hoffmann, GmbHR 2023, 709, 717 (Rdn. 23). |
| 24 |
| 25 | Vgl. die Schätzungen bei Bayer/Hoffmann, GmbHR 2012, R289 f. In den ersten beiden Jahren ihres Bestehens soll die Insolvenzquote laut einer Erhebung der Creditreform 2,15 % betragen haben, bei GmbHs im Vergleichszeitraum lediglich 0,46 %, vgl. Creditreform, Wirtschaftsdatenbank (2010): abrufbar unter http://www.creditreform.de/deutsch/creditreform/presse/archiv/insolvenzenneugründungenlöschungen/de/2010–Jahr/2010–11–29insolvenzenneugründungenlöschungen.pdf und Bürgel, (http://www.buergel.de/images/content/pdf/firmeninsolvenzen-erstesquartal-2012.pdf). |
| 26 | Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 19. |
| 27 | Anfang 2023 gab es 1.306.172 Voll-GmbHs und 186.091 Unternehmergesellschaften, vgl. Bayer/J. Lieder/Hoffmann, GmbHR 2023, 709, 715 (Rdn. 13). Von den 18.100 Unternehmensinsolvenzen 2023 entfallen auf die Voll-GmbH 42,7 % aller Insolvenzen, auf die UG 10,7 %. In absoluten Zahlen bedeutet dies: 7.674 Insolvenzen einer Voll-GmbH und 1.936 Insolvenzen einer UG. |
| 28 | Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 19. |
| 29 | Dies für den Zeitraum 2013–2017 nachweisend Bayer/Hoffmann, GmbHR 2018, 1156, 1160, die darauf hinweisen, dass in dieser Periode zwischen 56 % und 60 % aller UG-Insolvenzverfahren mangels Masse nicht eröffnet wurden. |
| 30 | Vgl. den Nachweis der Insolvenzstatistik in Fn. 24 sowie Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 19. |
| 31 | Laut Niemeier, ZIP 2007, 1794, 1801, gab die Hälfte der in Deutschland inkorporierten Limiteds binnen eines Jahres auf, der Großteil der verbliebenen Hälfte im zweiten Jahr. Die Überlebensfähigkeit anderer Kapitalgesellschaften soll 23-mal höher gewesen sein. Niemeier versuchte auch erste Indikatoren für die ihm prognostizierte “Frühsterblichkeit” der UG herauszuarbeiten, scheiterte aber letztlich am Fehlen konkreter Erhebungen, die zwischen GmbH und UG differenzieren, vgl. Niemeier, FS Roth, 2011, S. 533, 549 f.; eine Frühsterblichkeit bezweifelnd hingegen Bayer/Hoffmann, NZG 2012, R289 f. |
| 32 | Niemeier, ZIP 2007, 1794, 1801. |
| 33 | Vgl. bereits Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 19. |
| 34 | Formulierung nach Heckschen, DStR 2009, 166, 170. |
| 35 | Ulmer, GmbHR 2010, 1298, 1300 ff. |
| 36 | Ulmer, GmbHR 2010, 1298, 1302. |
| 37 | Habersack, GWR 2010, 107, 109; Pentz, FS Goette, 2011, S. 355, 357 ff.; Kleindiek, FS Hopt, 2010, S. 941 ff.; Kersting in: VGR, Gesellschaftsrecht in der Diskussion 2008, 2009, S. 101, 122 f.; Hennrichs, NZG 2009, 921, 923 f.; ders., NZG 2009, 1161, 1164; Witt, ZIP 2009, 1102, 1104 f.; Goette in: Goette/Habersack, Das MoMiG in Wissenschaft und Praxis, 2009, § 9 Rdn. 24; Grigoleit/Rieder, GmbH-Recht nach dem MoMiG, 2009, Rdn. 181; Heinze, GmbHR 2008, 1065, 1066 f.; Herrler, DB 2008, 2347, 2349 f.; Karl, GmbHR 2020, 9, 12; J. Lieder/Becker, NZG 2021, 357, 363 sowie aus dem Genre der Kommentarliteratur Rowedder/Pentz/Pentz, GmbHG, 6. Aufl. 2024, § 19 Rdn. 179 f.; Lutter/Hommelhoff/Bayer, GmbH-Gesetz, 21. Aufl. 2023, § 19 Rdn. 69, als auch Lutter/Hommelhoff/Kleindiek, GmbH-Gesetz, 21. Aufl. 2023, § 5a Rdn. 28 f.; Scholz/Westermann, GmbHG, 13. Aufl. 2022, § 5a Rdn. 20 f.; MünchKommGmbHG/J. Lieder, 4. Aufl. 2022, § 56 Rdn. 109 f.; MünchKommGmbHG/Rieder (Fn. 15), § 5a Rdn. 26; MünchKommGmbHG/Schwandtner, 4. Aufl. 2022, § 19 Rdn. 182; Michalski/Heidinger/Leible/Schmidt/Schmidt, GmbHG, 4. Aufl. 2023, § 5a Rdn. 10; Altmeppen, GmbHG, 11. Aufl. 2023, § 5a Rdn. 24; Saenger/Inhester/Kruse/Pfisterer, GmbHG, 5. Aufl. 2024, § 5a Rdn. 14; Noack/Servatius/Haas/Servatius, GmbHG, 23. Aufl. 2022, § 19 Rdn. 48. |
| 38 | Lutter/Hommelhoff/Bayer (Fn. 37), § 19 Rdn. 69. |
| 39 | Lutter/Hommelhoff/Kleindiek (Fn. 37), § 5a Rdn. 28 unter Berufung auf Lutter/Hommelhoff/Lutter, GmbH-Gesetz, 17. Aufl. 2009, § 5a Rdn. 13, dem geistigen Vater dieser Wendung; ebenso noch Altmeppen/Roth/Roth, GmbHG, 8. Aufl. 2015, § 5a Rdn. 21. |
| 40 | Vgl. abermals Ulmer, GmbHR 2010, 1298, 1301 ff., ebenso Schäfer, ZIP 2011, 53, 56 f.; Bormann, ZIP 2007, 891, 901; Bormann/Urlichs, GmbHR 2008, Sonderheft Oktober, 38, 42; Markwardt, BB 2008, 2414, 2421; Freitag/Riemenschneider, ZIP 2007, 1485, 1486; Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, 22. Aufl. 2019, § 19 Rdn. 48; Bork/Schäfer/Schäfer, GmbHG, 5. Aufl. 2022, § 5a Rdn. 23; neuerdings auch Rowedder/Pentz/Raff, GmbHG, 6. Aufl. 2024, § 5a Rdn. 23 und im Erg. auch Wicke, GmbHG, 5. Aufl. 2024, § 5a Rdn. 8 (§ 5a Abs. 2 S. 2 GmbHG sei eine den § 19 Abs. 4 GmbHG verdrängende Spezialvorschrift). |
| 41 | Pentz, FS Goette, 2011, S. 355, 357 ff.; Rowedder/Pentz/Pentz (Fn. 37), § 19 Rdn. 179 f.; Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 50, § 19 Rdn. 120 f. |
| 42 | Der maximale Streitwert beträgt knapp 25.000 Euro, wird in der Praxis aber regelmäßig deutlich geringer ausfallen. Praktisches Fallmaterial ist bisher nicht veröffentlicht. |
| 43 | Dafür vor allem Hennrichs, NZG 2009, 1161, 1164; Spies, Unternehmergesellschaft [haftungsbeschränkt], 2010, S. 159 f.; dem folgend auch noch Ulmer/Habersack/Winter/Paura (Fn. 8), § 5a Rdn. 49, 66; grds. auch Klose, GmbHR 2009, 294, 295 f., der dann aber für die Sachkapitalerhöhung in die GmbH differenzieren wollte. |
| 44 | Ulmer, GmbHR 2010, 1298, 1299 f. |
| 45 | Ebenso die heute wohl ganz h.M., vgl. nur Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 51 f. m.w.N. sowie den Nachweis in Fn. 47. |
| 46 | Ulmer, GmbHR 2010, 1298, 1300. |
| 47 | So in Anschluss an BGHZ 189, 254 = NJW 2011, 1881 = GmbHR 2011, 699 m. Anm. Miras, DStR 2011, 1379, die heute ganz überw. Auffassung, vgl. etwa OLG München NZG 2011, 104; OLG Hamm BeckRS 2011, 13444 = RNotZ 2011, 439; OLG Stuttgart DStR 2011, 2261; MünchKommGmbHG/Rieder (Fn. 15), § 5a Rdn. 28; Bork/Schäfer/Schäfer (Fn. 40), § 5a Rdn. 21; Lutter/Hommelhoff/Kleindiek (Fn. 37), § 5a Rdn. 23 f.; Rowedder/Pentz/Raff (Fn. 40), § 5a Rdn. 29; Michalski/Heidinger/Leible/Schmidt/Schmidt (Fn. 37), § 5a Rdn. 11; Wicke (Fn. 40), § 5a Rdn. 7; Altmeppen (Fn. 37), § 5a Rdn. 21; Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 51 f. m.w.N. |
| 48 | Vgl. statt Vieler Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 74 m.w.N. |
| 49 | Noack, DB 2007, 1395, 1396; Bork/Schäfer/Schäfer (Fn. 40), § 5a Rdn. 1. |
| 50 | Vgl. näher zu diesen Fällen Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 90 ff. m.w.N. |
| 51 | Zutreffend bereits Freitag/Riemenschneider, ZIP 2007, 1485, 1488; Gehrlein, Der Konzern 2007, 771, 781; Gehrlein/Witt/Vollmer, GmbH-Recht in der Praxis, 4. Aufl. 2019, Kap. 1, Rdn. 81; Hirte, ZInsO 2008, 933, 935; Joost, ZIP 2007, 2242, 2247; Neideck, GmbHR 2010, 624, 627 sowie eingehend Müller, ZGR 2012, 81, 92 ff. mit zahlreichen weiteren Nachweisen. |
| 52 | Ausführlichere Begründung bei Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 18–20. |
| 53 | Seibert, FS Krieger, 2020, S. 911, 919; Weinmann, GmbHR 2022, 191, 194 f.; ebenfalls Reformbedarf anmahnend Beurskens, NZG 2016, 681, 683. |
| 54 | Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 36. |
| 55 | OLG Karlsruhe GmbHR 2014, 752 f. |
| 56 | Dies deckt sich mit dem bisher eher geringen Diskussionstand zu dieser Frage, vgl. vor allem Heinze, ZNotP 2012, 87 ff.; ders., NJW 2020, 3768 ff.; Lubberich, DNotZ 2016, 164 ff.; Heidinger/Knaier, FS 25 Jahre DNotI, 2018, S. 467 ff.; Wicke, GmbHR 2018, 1105, 1107–1109; Szalai/Kreußlein, notar 2019, 283 ff.; Späth-Weinreich, BWNotZ 2020, 98 ff. mit Replik von Becker, BWNotZ 2020, 154 und Duplik von Späth-Weinreich, BWNotZ 2020, 155. |
| 57 | Ebenso OLG Karlsruhe GmbHR 2014, 752, 753; FG Münster BeckRS 2009, 26027479; Noack/Servatius/Haas/Servatius (Fn. 37), § 5 Rdn. 20; Karl, GmbHR 2020, 9, 17 f. (Rdn. 39 f., 42); Späth-Weinrich, BWNotZ 2020, 155, 156; Heinze, NJW 2020, 3768, 3769; Lubberich, DNotZ 2016, 164, 175. |
| 58 | So vor allem Heidinger/Knaier, FS 25 Jahre DNotI, 2018, S. 467, 475 (erweiternde Auslegung); Szalai/Kreußlein, notar 2019, 283, 292; Henssler/Strohn/Schäfer, Gesellschaftsrecht, 6. Aufl. 2024, § 5a GmbHG Rdn. 19; Berkefeld in: Heckschen/Heidinger, Die GmbH in der Gestaltungs- und Beratungspraxis, 5. Aufl. 2023, S. 1156. Dabei wird teilweise zwischen der Einlage eines einzelkaufmännischen Unternehmens und einer Beteiligung an einer GmbH unterschieden, vgl. Heidinger/Knaier, ebda. S. 475 ff. |
| 59 | Wie hier im Ergebnis auch Karl, GmbHR 2020, 9, 17 (Rdn. 38 f.); Späth-Weinrich, BWNotZ 2020, 155, 156; Noack/Servatius/Haas/Servatius (Fn. 37), § 19 Rdn. 52a; so wohl auch MünchKommGmbHG/Schwandtner (Fn. 37), § 19 Rdn. 191; Rowedder/Pentz/Pentz (Fn. 37), § 19 Rdn. 103. |
| 60 | Karl, GmbHR 2020, 9, 17 (Rdn. 38); dies andeutend auch Szalai/Kreußlein, notar 2019, 283, 292. |
| 61 | Ausführlicher zum Ganzen demnächst Casper in einem Festschriftbeitrag, der in der zweiten Jahreshälfte 2025 erscheinen wird sowie einstweilen Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5 Rdn. 192. |
| 62 | Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5 Rdn. 192 m.w.N. |
| 63 | Gegen eine Werthaltigkeitsprüfung BFHE 229, 518 = NZG 2011, 118, 119 f. (Rdn. 31): Lutter/Hommelhoff/Bayer (Fn. 37), Rdn. 44; Lubberich, DNotZ 2016, 164, 176 f.; Karl, GmbHR 2020, 9, 14 f. (Rdn. 26 ff.); Späth-Weinrich, BWNotZ 2020, 155, 157; Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5 Rdn. 192. |
| 64 | Vgl. nur die vorstehend Genannten. |
| 65 | A.A. aber Herchen, Agio und verdecktes Agio im Recht der Kapitalgesellschaft, 2004, S. 139 ff., 339 ff.; Herchen, GmbHR 2008, 150 m.w.N. |
| 66 | OLG Karlsruhe GmbHR 2014, 742, 743; Lutter/Hommelhoff/Bayer (Fn. 37), Rdn. 44 in Anschluss an Wicke, GmbHR 2018, 1105, 1108; Karl, GmbHR 2020, 9, 15 ff. (Rdn. 30, 34 f.); Szalai/Kreußlein, notar 2019, 283, 296; enger Lubberich, DNotZ 2016, 164, 175 ff.; Heidinger/Knaier, FS 25 Jahre DNotI, 2018, S. 467, 486 f.; zweifelnd, aber letztlich offenlassend, Heinze, ZNotP 2012, 87, 89 f.; Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5 Rdn. 194. |
| 67 | Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5 Rdn. 194 im Anschluss an Wicke, GmbHR 2018, 1105, 1108; ebenso Szalai/Kreußlein, notar 2019, 283, 296. |
| 68 | Wicke, GmbHR 2018, 1105, 1108; nur für das eingebrachte einzelkaufmännische Unternehmen bejahend, für GmbH-Geschäftsanteile ablehnend Heidinger/Knaier, FS 25 Jahre DNotI, 2018, S. 467, 487. |
| 69 | Karl, GmbHR 2020, 9, 16 (Rdn. 30). |
| 70 | Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5 Rdn. 194. |
| 71 | Lutter/Hommelhoff/Bayer (Fn. 37), § 5 Rdn. 44; ausführlich zum Ganzen Szalai/Kreußlein, notar 2019, 283, 293 ff. m.w.N.; dafür auch Karl, GmbHR 2020, 9, 18 (Rdn. 45), der aber (a.a.O. Rdn. 42) zugleich § 19 Abs. 4 anwenden will; eine Differenzhaftung zumindest erwägend auch Heidinger/Knaier, FS 25 Jahre DNotI, 2018, S. 467, 475. |
| 72 | Ausdrücklich bejahend Lubberich, DNotZ 2016, 164, 172; Wicke, GmbHR 2018, 1105, 1107 f.; Karl, GmbHG 2019, 9, 13; Heinze, NJW 2020, 3768, 3769; Heckschen/Heidinger (Fn. 58), S. 620 Rdn. 57; Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 54; der Sache nach auch OLG Karlsruhe GmbHR 2014, 752 f. mit insoweit wohl zustimmender Anm. von Wachter sowie ferner Rieder in: MünchKommGmbHG (Fn. 15), § 5a Rdn. 22. |
| 73 | Habersack/Casper/Löbbe/Casper (Fn. 6), § 5a Rdn. 48; MünchKommGmbHG/Rieder (Fn. 15), § 5a Rdn. 22 m.w.N. |
| 74 | Vgl. oben II. |
| 75 | Dass der in die Kapitalrücklage gebuchte Betrag aus einem Sachagio zu einem späteren Zeitpunkt Grundlage für eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sein kann, stellt hingegen keinen Hinderungsgrund für die Zulässigkeit der Bareinlage mit Sachagio dar, da diese aufgrund einer geprüften Bilanz erfolgt, vgl. OLG Hamm DStR 2008, 989 (zur AG); Priester, FS Roth, 2011, S. 573, 580 f.; Wicke, GmbHR 2018, 1105, 1109 m.w.N. |