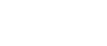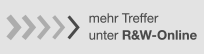Bundestagswahl 2025 – was erwartet uns im Arbeitsrecht

Hände weg vom Arbeitszeitgesetz!
Am 23.2.2025 wurden in Deutschland die Weichen für eine neue Bundesregierung gestellt; aktuell führen CDU/CSU und SPD Koalitionsverhandlungen. Ihr Anfang März 2025 veröffentlichtes Sondierungspapier gewährt erste Einblicke, welche Vorhaben überlegt werden; viele Vorhaben sind gut, einiges sollte besser nicht umgesetzt werden.
So enthält das Sondierungspapier von Union und SPD u. a. die Verabredung, statt täglichen Höchstarbeitszeiten künftig unter Berufung auf die Möglichkeiten des EU-Arbeitszeitrechts wöchentliche Höchstarbeitszeiten in Deutschland einzuführen; die geltenden Ruhezeiten sollen beibehalten werden. Dieses Vorhaben ist kategorisch abzulehnen; es bedeutet die Aufgabe des 8-Stunden-(bzw. 10-Stunden-)Tages und die Abkehr von schützenden Grundpfeilern des bisherigen deutschen Arbeitszeitrechts. Art. 6 der EU-ArbZ-RL sieht zu wöchentlichen Höchstarbeitszeiten Folgendes vor: Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit nach Maßgabe der Erfordernisse der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer die durchschnittliche Arbeitszeit pro Siebentageszeitraum 48 Stunden einschließlich der Überstunden nicht überschreitet (Durchschnitt innerhalb von 4 Monaten, Art. 16 RL 2003/88). Rein rechnerisch wären danach unter Berücksichtigung der täglichen Ruhezeit und Pausenzeiten jeweils 12,15 Stunden Arbeit pro Arbeitstag möglich; in einzelnen Wochen innerhalb des viermonatigen Bezugszeitraums kann die Arbeitszeit auch bei deutlich mehr als 48 Stunden pro Woche liegen. Studien der BAuA zu Arbeitszeitwünschen der Beschäftigten zeigen, dass mehr als die Hälfte der Beschäftigten (53 %), insbesondere Vollzeitbeschäftigte, ihre Arbeitszeiten verkürzen und nicht verlängern möchte. Valide Empirie zeigt zudem, dass ab einer Arbeitszeit von mehr als acht Stunden am Tag Unfallrisiko und Fehleranfälligkeit deutlich zunehmen, ab der zwölften Stunde verdoppelt sich das Unfallrisiko – das kann weder im Beschäftigten- noch im Unternehmensinteresse liegen. Von täglichen Höchstarbeitszeiten völlig losgelösten Arbeitszeitregelungen steht auch die EU-RL 89/391 zu Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer entgegen, die auch im Kontext der EU-ArbZ-RL 2003/88 gilt. Hinzu kommt, dass in 2024 rund 552 Millionen bezahlte und 638 Millionen unbezahlte Überstunden geleistet wurden. Statt das ohnehin bereits höchst flexible deutsche Arbeitszeitrecht weiter zu flexibilisieren und Arbeitsschutzniveaus zu reduzieren, sollte sich vorrangig um die Einhaltung der bereits existierenden Arbeitszeitregelungen gekümmert, Überstunden durch mehr Personal und Zuweisung angemessener Arbeitsumfänge vermieden bzw. Überstunden überhaupt erst einmal bezahlt werden. Darüber hinaus ist die Zahl der durch die Arbeitsschutzaufsicht kontrollierten Betriebe seit Jahren rückläufig, hier sollte mehr Personal eingestellt werden, damit Verstöße entdeckt und geahndet werden. Vorrangig wäre zudem, das heutige Arbeitszeitgesetz unionsrechtkonform auszugestalten; mehrere Paragrafen dürften bereits heute nicht EU-rechtskonform sein, angefangen u. a. beim Ausgleichszeitraum des § 3 S. 2 ArbZG, über § 7 Abs. 2a ArbZG und diesbezüglich fehlenden gesetzlichen Höchst- und Mindestgrenzen sowie § 16 Abs. 2 ArbZG (Erfassung von Arbeitszeiten erst ab der neunten Stunde), aber auch § 18 Abs. 1 Nr. 1 und 3 ArbZG – die generelle Herausnahme von Leitenden Angestellten sowie der Hausangestellten aus dem Anwendungsbereich des ArbZG und wie häufig vorgeschlagen aus der Arbeitszeiterfassung – beides dürfte nicht mit Art. 17 der EU-ArbZ-RL vereinbar sein; gegen die generelle Herausnahme von Hausangestellten spricht auch die EuGH-Entscheidung vom 19.12.2024 – C-531/23, juris.
Vorgesehen im Sondierungspapier ist auch die Steuerfreiheit von Mehrarbeitszuschlägen für Vollzeitbeschäftigte. Auch das dürfte im Hinblick auf die BAG-KfH-Entscheidung (5.12.2024 – 8 AZR 370/20, juris) und die EuGH-Entscheidungen KfH Dialyse und Lufthansa Cityline (EuGH 29.7.2024 – C-184/22, C-185/22, RIW 2024, 683; 19.10.2023 – C-660/20, RIW 2024, 131) problematisch sein. Seit der BAG-Entscheidung KfH ist klar, dass auch Teilzeitbeschäftigte grundsätzlich ab der ersten Überstunde einen Anspruch auf Überstundenzuschläge haben – alles andere ist eine unzulässige Diskriminierung von Teilzeitenbeschäftigten und eine mittelbare Frauendiskriminierung. Ob die im Sondierungspapier enthaltene Begründung “Damit sich Mehrarbeit auszahlt. . .” und Schaffung von Anreizen für Teilzeitler, ihre Arbeitszeit zu erhöhen, eine ausreichende Rechtfertigung entsprechender Differenzierungen sein kann, ist mehr als zweifelhaft. Auch dieses Vorhaben ist daher abzulehnen.
Abzulehnen ist auch die im Kontext Bürokratieabbau vorgesehene Abschaffung des sog. Goldplating. Überlegungen der möglichen künftigen Koalition sind insoweit, dass in Deutschland EU-Richtlinien nur noch 1 : 1 umgesetzt werden; besseres deutsches Recht wäre entsprechend zu deregulieren bzw. kein besseres nationales Recht mehr möglich. Ähnliche Initiativen gab es vom Bundesrat und der EU-Kommission Anfang 2025. Maßstab für Rechtssetzung muss sein, was für Deutschland nötig und wichtig ist; wenn deutsches Recht über EU-Recht hinaus geht, dann gibt es dafür einen guten Grund.
Statt zu deregulieren und Schutzrechte abzubauen, sollten vielmehr wichtige der bisher nicht umgesetzten, aber z. B. im Koalitionsvertrag 2017–2021 und/bzw. 2021–2025 angekündigten Vorhaben weiterverfolgt und umgesetzt werden, wie die Schaffung eines Rechts auf mobiles Arbeiten, die Beschränkung des Befristungsrechts und die Reform des WissZVG, die Einführung eines Bundestariftreuegesetzes, gesetzliche Regelungen für ein digitales Zugangsrecht der Gewerkschaften, die Reform des § 119 BetrVG hin zu einem Offizialdelikt, die Einführung eines Beschäftigtendatenschutzgesetzes sowie die Abschaffung des kirchlichen Sonderarbeitsrechts etc. – einiges davon war in den seitens der Ampelkoalition 2024 vorgelegten Gesetzentwürfen bereits enthalten; dies gilt es aufzugreifen, anzupassen und fortzuschreiben.
Prof. Dr. Nadine Brandl, Leiterin Bereich Recht und Rechtspolitik, ver.di Bundesverwaltung, Berlin.